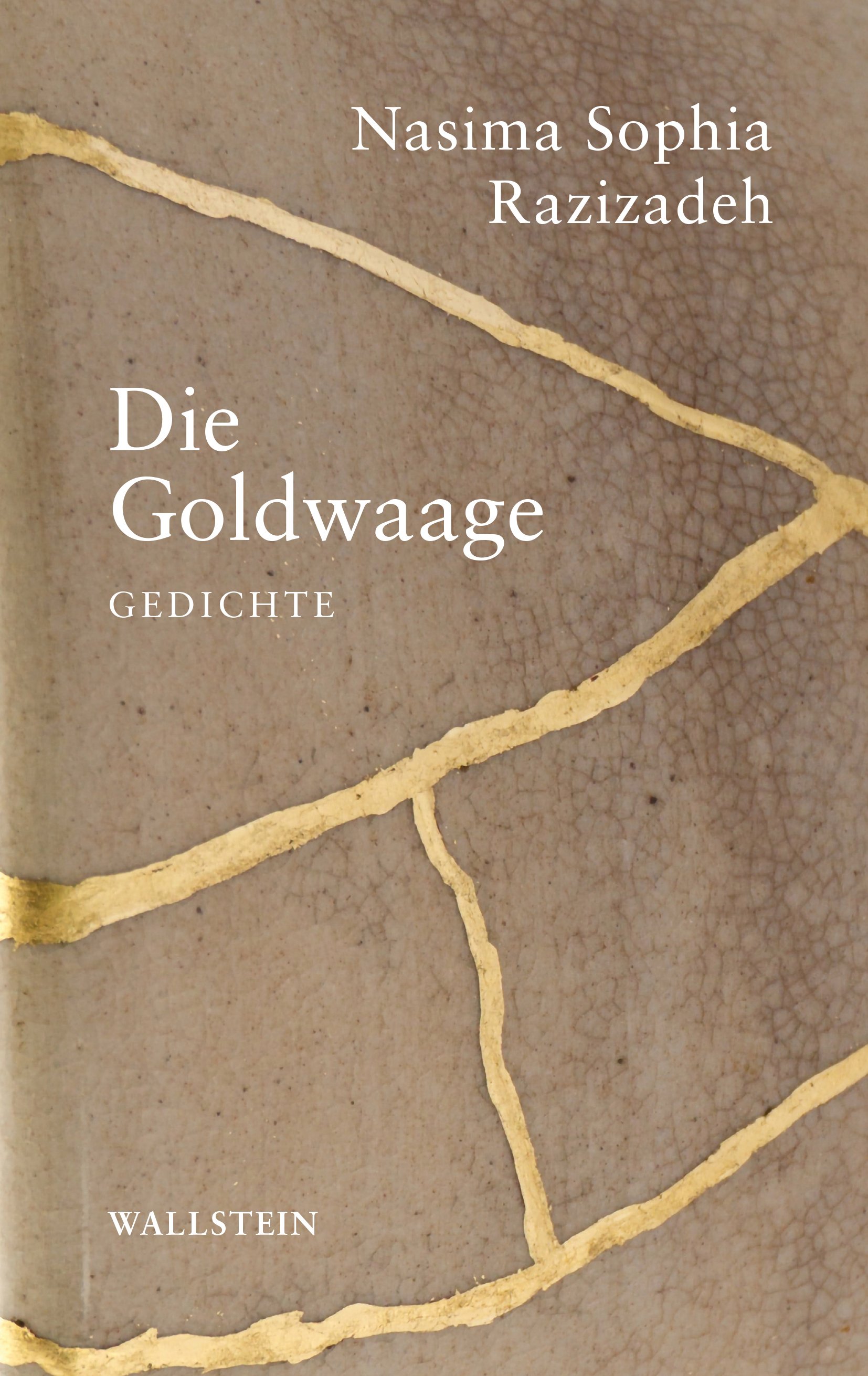Metamorphosen aus Mush und Mythos
Zu dem Gedichtband Mush von Sonja vom Brocke und seinen Metamorphosen
Spätestens seit ihrem Lyrikband Venice singt, erschienen 2015 bei kookbooks, gehört Sonja vom Brocke zu den außergewöhnlichsten Stimmen der zeitgenössischen deutschsprachigen Lyrik.
Versteinert zu Mythenkugeln, aber gelenkig, sprayt sie sich eine
Frisur. Prostet und redet wie eher, als sie Ritterin war, für
unangreifbare Flanken, in Abwesenheiten von Faxen und Draht.
—
In den Ampelphasen verhakt sich ein Rhythmus. Blumen-,
Lichtarrangements: Versuche absichtsloser Gestalt. Es werden
darüber Natur – Lady Gaga, Gummimuscheln, in denen Venice
singt: pump.
Dieser Auszug aus dem Gedicht Venice singt veranschaulicht beispielhaft vom Brockes poetologischen Ansatz. Zugleich enthält er bereits einige der Spurenelemente, die auf den Nachfolgeband Mush (kookbooks 2020) hindeuten, auf dessen radikal angewendetes Prinzip der Metamorphose aus Mythos und Natur.
I Ovid und die Pathogenese des Patriachats
Die Erde im Leib wachsen Schuppen, ein Schwanz muskulös sich sorgsam zu kringeln/ um die Gelenke der Väter, Mägen, in denen Larven gedeihen
empfindliche Schultern stülpen ein, denn hier schlägt auf: das Geschuppte, Plättchen für/ Plättchen streckt sich, blüht aus den Poren, wölbt sich, der Pockenhaut prunkt ein Rüstzeug
Konzeptionell in Teilen auf die Metamorphosen von Ovid zurückzugreifen, ist nicht die schlechteste Idee, bietet die Anlage der Metamorphosen doch zahlreiche Anknüpfungspunkte an aktuelle Diskurse. Ovids Metamorphosen zugleich als das bloßzustellen, was sie auch sind, ein Storytelling patriarchaler Ordnungs- und Herrschaftsstrukturen, ist nur einer der diskursiven Clous von Mush. Gleichsam als Kontrastmittel bleibt vom Brocke dem Zauber der Metamorphosen, ihren Resonanz-, aber auch Dissonanzräumen verpflichtet, folgt misstrauisch hingerissen ihren blutigen Spuren („weißt du, was geschieht, wenn du den Zauber aufsagst?”).
Najaden, Nachteule
Erdsänger~in
Virtuos verarbeitet vom Brocke das Metamorphosenmaterial, thematisiert die Opfer (Andromeda, Daphne, Syrinx usw.), verortet den Text inmitten einer fluide flimmernden Topografie aus Mondlandschaften, Gestrüpp-Müll-Kulissen, Stratosphären, Glashäusern, zerlumpten Erdhügeln und aus „Seifenblasen über dem Meer”; durchmischt es mit Zeitgeistligem, Posthumanistischem und Überwachungstechnologischem (Sonden, Sensoren und ihre Imperative), collagiert, collagiert das Collagierte, spannt es ein in komplexes Geschehen, wechselt hochdynamisch zwischen Makro- und Mikroebene.
Oder anders ausgedrückt: Mush ist ein Patchwork aus biologischen, mikrobiologischen, biophysikalischen, zoologischen und botanischen Elementen, eine anspielungsreiche Verzahnung der Sphären des Menschlichen, Tierischen, Pflanzlichen, Dinglichen und Technischen, und nichts davon nimmt einen privilegierten Status ein.
Mush beschreibt Augenblickliches kurz vor oder nach der Metamorphose oder mittendrin, oder gerade im Abbruchversuch, alles im rasanten Wechsel und gerne in Gemetzel ausartend.
Das Fantom legt sein Graukleid ab.
Noch ringen die Nervengouvernanten um ihre Hoheit im Amt.
Succubi fetzen Flügel.
Kein Schritt ohne ihr Frohlocken. Das linke Bein knüppeln sie taub
Dann fressen sie sich gegenseitig auf.
II DIE PERFORMANZ DES HYBRIDEN / DAS BEGEHREN DER SENSOREN
Herauskristallisiert werden Hybridwesen („Ährenclowns”, „Sprösslingsgestalt”) mit spezifisch-unspezifischen Hybridmerkmalen („Vergissmeinnicht-Knochenwuchs”, „Chitinwimpern”, „Walnussmaske”), die — mal einer „Paragrafenmaschine” ausgesetzt, mal „aus dem Gelenk schlürfen” —, in verschiedenen Anproben durchgespielt werden, um mit Geckos oder Orang-Utans gemeinsame Sache zu machen, Luchse zu erfinden, sich in ein „Blumen-Ich” zu verwandeln, „in einer Gegend/ die aus Rastern schweift/ Sage/ die sich kugelt.”
Und genau dieses Verweisen auf Hybrid-Fluides, das Nachfühlen essentiell gesetzter Schemenhaftigkeit („wie leer sich ein Körper anfühlen kann”) koppelt vom Brocke an rhizomatische Strategien des Denkens, wie sie einst von Deleuze und Guattari eingeführt wurden. Ein nomadisches (Nicht-)Denken, alles ist in Bewegung, ständig ein Kribbeln, Flickern, Schlürfen, Schwirren, Sprudeln, Strömen, Krähen, Kullern, Kugeln, Herumtapsen, Abprallen, in die Tiefe Fallen usw., ohne festen Ort, verstrickt in ein Werden der Vielheiten samt Verkettungen, verbunden mit dem Gestus der Ovidschen Metamorphosen.
Selbst die DNA wird in diese Dynamisierungen einbezogen.
DNA spannt, kurvt sanft. Abertausende Härchen um
einen gestochenen Tag
Mit performativer Agilität auf der Klaviatur flüssige Akkordwechsel zu spielen, beherrscht vom Brocke in allen erdenklichen Variationen, de/rekonstruiert Ein-/Aus-/Übertritte, synästhetische Häresien, Familienaufstellungen.
Mal Morgenstern-like in Nuce: „Die Träne/ im Omlette … blubbt” — mal psychodramatisch die Verhärtungen einer Familienkonstellation nachspürend: „Auf der Treppe die Mutter weinend. Auf der Treppe die Mutter, den Bruder im Arm. Die Mutter weint. Die Großmutter neben dem Großvater im Schlafzimmer unten. Der Vater weinend? der Vater?”
Wie ein überdrehter Touristguide lockt uns vom Brocke von einer Fontanelle zur nächsten, von denen sich keine verschließen will, stattdessen fortlaufend Rekonfigurationen zerstückelter Metamorphosen ausspuckt.
Variantenreich umkreist sie die Imperative von Überwachungsdispositiven, gewählter oder ausgesetzter Sozialpathologien, teasert Kollapspolitiken an, changiert zwischen formlos und geballt.
„Aber die Technik prüft. Nie sind wir intim, wenn ich deine Finger kalkuliere, das Maß vom Scheitel — Steiß dein Gedeihen taxiert.”
Mush aber auf regulierendes Wirken von Sicherheitsdispositiven, auf eine im Text aufglänzende Traumdimension samt ihren Metamorphosen zu reduzieren, wäre zu simpel.
So bleibt es offen oder subjektiver Interpretation überlassen, wer oder was durch wen oder was überwacht wird und warum überhaupt, und wer durch wen oder was in wen oder was verwandelt wird und warum überhaupt.
Im Umkehrschluss bedeutet das aber keineswegs, dass all die Interpretationsoffenheit verwässert wird durch willkürliche Aneinanderreihungen von Micro-Fictions, Kurzszenen oder Sinnpartikeln. Sie ist vielmehr Ergebnis eines stringenten Kalküls, eines Beziehungsgeflechts, das auf einem vibrierenden Feld von Möglichkeiten zur Aufführung gebracht wird. Der eigentliche Setzkasten schimmert immer wieder durch.
Ich sehe die Trennlinie weichen
und doch ist sie da.
Zugleich öffnet sich die scheinbare Hermetik für die Revolte, die Neuerung, ihr Scheitern, ihr Neuansetzen: Dem Anpassungsdruck etwas entgegensetzen, durch versuchte, abgebrochene, aufgeflogene, aufgezwungene, zwanghafte Metamorphosen. Die Metamorphose als Technik des Flüchtens, Ausweichens, sich Unsichtbarmachens, als mal softe, mal gewalttätige Guerillapraxis, als Praxis der Tarnung, verdeckter Angriffe, sozialer Performance. Metamorphose als Krankheit, als Phobie, als Missbrauch von außen oder innen, als Ausgeliefertsein, als Grenzüberschreitung, aber auch als Spiel, als Duell.
„Lernen uns kennen, indem wir uns verwandeln”, lautet ein Resümee, gleichzeitig beansprucht das lyrische Ich die Gestaltungshoheit („Ich gestalte”), fordert: „muss gebündelt bleiben”.
Überall lauern Zurichtungen, die am lyrischen Ich von allen Seiten zerren, es aushöhlen, verdichten, zerreißen, den Scherbenhaufen zusammenkehren, neu zusammenfügen, Form/Formation, die mit genuiner Verwandlungsfähigkeit um Reste von Intimität ringt, ihren Verlust beklagt; Sensoren einer permanenten Zustandsüberwachung, die das Spiel der Ovidschen Götter im Modus des Ausgekühltseins aufzeichnen, den Menschen (oder das, was von ihm übriggeblieben ist) vor sich hertreiben von Metamorphose zu Metamorphose, nicht lockerlassen — aufgebürdet das kalte Begehren der Technik, um in alle Ritzen intimer Körperlichkeit einzudringen, den Taumel zu obduzieren, auszumessen, Besitz zu ergreifen, Narrative zu kapern; aufgebürdet das lauernde Begehren des prothetisch steigerbaren Subjekts, wie weit es noch gehen kann; aufgebürdet die Schnittmenge von Condition Monitoring und formbarem Subjekt.
Und ein Boosten im Stängel
erst strotze ich
dann knicke ich ein.
In letzter Konsequenz wandelt sich das Konzept der Metamorphose realiter (und in Mush eher unausgesprochen, aber als Hintergrundfolie immer präsent) zu einem globalen Geschäftsmodell. So erscheint jeder Versuch sich der Observierung qua Metamorphose entziehen zu können als illusionär, weil selbst dieses Schlupfloch von den Sensoren antizipiert wird.
„Unter den Abwehrschirmen lässt es sich leben”, heißt es an einer Stelle, aber es ist ein trügerisches Idyll („Lotuskompanie im Glashaus”). Die Allgegenwart der Sensoren („Sensoren in den Wangen … Chitindepots hinter den Sperrcodes”) blockt Akte der Befreiung, oder um es mit Audre Lorde zu sagen, „the master’s tools will never dismantle the master’s house.”
Formal spiegelt sich das im Fragmentarischen, Skizzenhaften, im scheinbar Sprunghaften, in freischwebenden Assoziationsketten, in Deformierung der äußeren Form/Formation, in der Konstruktion von Nicht-Heimat, „De-from … Nicht-Nist”, wie es im Intro „Heaps” heißt.
III MEET ME AT THE DESERTSHORE
Mush ist ein feministischer Röntgenblick auf die Tücken und Fallstricke von Konzepten des Metamorphischen. Ovids Metamorphosen veranschaulichen Wirkungsweisen autoritärer Patriarchalismen, ihre Strukturen und Praktiken. Großes Mitleiden mit den Opfern ist von Ovid nicht zu erwarten. Die Gewaltdarstellungen sind oft Body Horror, und Ovid sieht sich in der Rolle des genüsslichen Schaulustigen, der die göttlich-patriarchalen Ränkespiele en détail in daktylische Hexameter presst.
Dennoch erschöpft sich das Konzept der Metamorphose keineswegs in dieser historisch einzuordnenden Engführung. Die Metamorphosen lassen sich poetologisch umfassender verstehen, etwa im Sinne einer planetarischen Pansexualität, die alle Arten und Geschlechter transzendiert, wie es Paul B. Preciado vorschwebt: ein „Technoschamanismus, ein System der Kommunikation zwischen den Arten”. Mush praktiziert einen empathisch-kühlen Blick auf die eigene Ausgesetztheit, im Mythos verfangen und den Mythos nutzend als Sprungbrett, sich jenem Verfangensein zu entledigen.
Auf einer weiteren Ebene stellt vom Brocke den Ovidschen Metamorphosen exemplarisch die Metamorphosen der Musikerin und Schauspielerin Nico entgegen. Die in Nazideutschland als Christa Päffgen geborene Nico begann schon früh ihre Herkunft zu mystifizieren, gehörte in den 1950ern als erste Deutsche zu den international erfolgreichsten Models, geriet dann in den Dunstkreis von Andy Warhols Factory und war kurzzeitig Sängerin der Band Velvet Underground. Eingezwängt von sexistischen Zuschreibungen und Femme Fatale-Klischees, vollzog sie Anfang der 1970er einen radikalen Bruch, begann sperrig-frostige Avantgardealben aufzunehmen und wirkte in einigen exzentrischen Arthouse-Filmen von Philippe Garrel mit. In Mush wird auf Nico fortlaufend Bezug genommen, die aller Verspottung trotzend konsequent ihren Weg ging, weg von „Glücksklimpereien”, den Spieß umdrehte, selbst „Chevalier” wurde, weißgewandet auf einem Schimmel sitzend und von ihrem ebenfalls weiß gewandeten Sohn Ari durch eine flache Wüstenlandschaft geführt wird. Sich ganz dieser Metamorphose, dem Exzess der Selbstbefreiung hingebend und für das Musik-Business zugleich wieder nur das Klischee einer selbstzerstörerischen Drogenikone verkörpernd. In dem Song „Le Petit Chevalier” aus dem Album Desertshore, auf das vom Brocke im Anmerkungsteil verweist und dessen Text in deutscher Übersetzung in Mush zitiert wird, heißt es: „avec le ciel dessus mes yeux … avec la terre dessous mes pieds.”
Maximale Entgrenzung, Chevalier werden, den Blick von oben und von unten, es transzendierend, auch als weibliches, sich vom Weltlichen loslösendes Begehren, sich frei machen von fremdbestimmten Zuschreibungen und Zurichtungen, immer tiefer in die Wüste hinein, bis zu Deserthorse, bis der Bannkreis sich schließt.
Augen auf, Traumbrösel verteilen
um den Bannkreis Ringelblumen säen
IV UND DANN IM TÜMPEL (UND AUS IHM HERAUS)
Der Tümpel endlich beruhigt mich
Wie auch immer im Nachhinein der Lebensweg von Nico gedeutet werden kann: als tragisch, vergeudet oder bahnbrechend und im Nachhinein rehabilitiert, wie auch immer ein gelingendes oder nicht-gelingendes Leben festgestellt werden mag, bedarf es eines zusätzlichen Kunstgriffs, um sich aus inneren oder äußeren Verstrickungen zu befreien. Um auf Paul B. Preciado zurückzukommen: Schlag dir aus dem Kopf, etwas Besonderes zu sein. Es ist wie auf einer Theaterbühne: Jeder kann die Rolle jedes beliebigen anderen spielen, auch im Sinne eines spekulativen Posthumanismus, der unentwegt beschworen und durchgespielt wird, ein fortlaufendes Anprobieren von tierischen oder pflanzlichen Verhaltensweisen, die Einverleibung gerissener Resilienz und Widerständigkeit. Leben im permanenten Übergang.
So schälte sie sich aus Faltenwürfen, Gesundheit.
Vom Brocke vergegenwärtigt die Metamorphose der Syrinx, die auf der Flucht vor Pan Artemis anfleht, sie in Schilfrohr zu verwandeln, damit sie nicht zur göttlichen Beute wird. Ovid verpasst dieser klassischen Rape-Geschichte einen kitschigen Move. Aus Pan wird ein leidender, sich verzehrender Liebesheld, der zum eigenen Trost aus dem Schilfrohr die Panflöte schnitzt. Damit wird die männliche Perspektive als Narrativ im Sinne einer Täter-Opfer-Umkehr dominant. In Mush wird Syrinx zunächst als trauriger Goth am Tümpel rekonstruiert als „Hampel-Fiepe”, bis das lyrische Ich in einem Akt kognitiver Emanzipation das Opfer erkennt, Abbitte leistet: „Wie konnte ich sie verhöhnen.”
Von Karpfen? Ein Karpfen springt aus dem Tümpel. Aus seinem Maul sprudelt Paste. Das Maul ist der Mund einer Diva. Die Lippen frech, geschwungen und satt: Das Maul der Kärpfin sprudelt und lacht, ihre Augen blitzen …
In dieser Passage komprimiert vom Brocke die Metamorphose der „Spitzwegzimmer”-Künstlerin Nico, ihr Erwachen, ein strahlendes Gewahrwerden. Nebenbei: in dem Wort Kärpfin klingt auch die aristokratische Gräfin an, ein Verweis auf Nicos Habitus. Einige Zeilen später endet die Passage: „… die Augen der Kärpfin zucken, ihre Lider fallen, die Diven-Züge mildern sich, sie geraten fischig, mit dem Maul voran stürzt ein Karpfen zurück in den Tümpel.”
Es ist ein Erwachen aus dem Exzess, vom Licht geblendet stürzt sie zurück in den Tümpel.
Nicos Versuch der Flugbahn männlichen Outsidertums zu folgen, endet bar jeder Anerkennung. Das klingt zunächst nach einem traurigen Ende. Aber es gibt auch eine andere Lesart.
Der Tümpel, der in Mush positiv konnotiert ist, ist ein Ort der Metamorphose, Mutterleib und Ankleide zugleich, ein dunkler Ort, an dem alles möglich ist. Es ist einerseits die Erkenntnis, dass wir alle „Beings from the Mud” sind, wie Donna Haraway nicht müde wird zu postulieren, anderseits Protagonist:innen in einem Wechselspiel zwischen „Fontanelle — Fontange” (so auch der Titel eines Kapitels), die sich ausgehend von der unverschlossen bleibenden Schädeldecke fortlaufend in Metamorphose begeben und bedrängt von Succubi und Tagen des Bluts in Cyborgs verwandeln, mit Natur bewaffnet, mit „Chitinwimpern”, geschuppten Leibern oder einer Pockenhaut als Rüstzeug. Diese Bewaffnung wird in Beziehung gesetzt zu der Mode der Fontange, einer Haubenform aus der Zeit Ludwig XIV., in der sich der Wille zur Selbststilisierung, eine Betonung aristokratischer Distinktion ausdrückt. Zugleich wird das Statuarische, die selbstauferlegte Unbeweglichkeit solch komplizierter Fontagen als Stadium einer Verpuppung aufgebrochen. Die Selbstzuschreibungen werden fluide, kippen ins Ambivalente, Un-Eindeutige, erschaffen wechselhafte Narrative, folgen blutigen Spuren, legen selbst Fährten, die in Labyrinthe führen, die uns Methoden der Befreiung und das Prinzip fortgesetzter Anhaftung lehren. Es ist ein Immerwiederneuansetzen, eine Bewegung von „Die Götter -/ lassen -/ nicht locker hin zu die Götter können mir nichts mehr.”
Die Komplexität dieses Bandes verbrämt aber keineswegs eine bloße Summierung erratischer Akkumulation. Vielmehr speist sie sich aus Matsch, Morast, Opak-Tümpelhaftem, dem Urschlamm, dem Mutterleib, im dem wir lebenslang festsitzen, um lebenslang dem Wunder des Ausbrechens, des Inslichtkommens teilhaftig zu werden, gerade weil wir uns verstehen als „ziggliedrige” Haufen-Geschöpfe aus zahllosen Identitäten, Avataren, Prägungen, Zuschreibungen, Traumata, Seifenblasen, Sehnsüchten, Fürsprachen, Auf- und Abwertungen.
Wir sind Schemen und wir können dieser Schemenhaftigkeit nicht trauen, weil sie und der Blick auf sie sich ständig ändert und ein klares Verständnis nur in vorgeschobener Undurchsichtigkeit möglich erscheint. In den Tümpel eintauchen, heißt, sehen lernen, das Spiel der Götter, Algorithmen und Dispositive zu durchschauen. Den Blick schärfen und vertraut machen mit der Ermöglichung von als unmöglich Deklariertem. Poesie als Exploration, ein dynamisiertes Innehalten, um das eigene Interpretieren in die Schächte des Oszillierens zu geleiten. Ein Perpetuum Mobile permanenter Neufindung.
Nebenbei ist Mush auch ein britischer Slangausdruck für Gesicht.
So sprecht mir ein Gesicht nicht ab –
unter Kosmik.
Ein Gesicht
um Gesicht um
Gesicht
Das eigene Gesicht als Signum von Souveränität, das eigene Gesicht aus dem Tümpelhaften neu erschaffen, es in einer Versuchsanordnung schichtweise übereinanderlegen.
V WÄRE / ICH DOCH / ‘NE NIESWURZ?
Im Kapitel „Wenn ich die Nieswurz bin, wer ist der Pflücker” schasst vom Brocke das Dogma erduldeter Unterwerfung und variiert Strategien selbstgewählter, transformierender Selbstvergiftung; veranschaulicht mittels Tarnung als Nieswurz (Blickfang und hochgiftige Pflanze zugleich) Vergiftungspraktiken gegen die Unterdrücker, die „Pflücker”, aktiviert eine Kunst des Einfädelns, um „den Pflückern zu trotzen”, sie anzulocken, sie im Kalkül der Rache zu erledigen, tödlich zu sein, wenn es draufankommt, ein killing them softly. Statt „Göttergrapschen/ -rache, Göttinnenmissgunst” wird ausgerufen: „Mücken und Kolibris, kommt!/ Neigt euch mir zu.”
„Heroentriumphe sind fade”, schreibt vom Brocke, und ergänzt: „Hier noch ein Skandal: Es geht auch darum, nicht zu sehen. Sich umzuwenden, informationslos.” Es ist das Ende aller Heldengeschichten, „in Wettern/ voll der Verwandlung”, in der „Mischmasch-Produktion”, irgendwo zwischen Hades und Eldorado, in Versen vollgestopft mit neodadaistischen „Fabelfragmenten”, Situationskomik, Jandl-Referenzen, Slapstick, der immer wieder ein Absplittern von den Hauptströmungen des Bandes vortäuscht.
Drachenjoke flitzt darüber / Flutschroute Kräuselschaum.
Ein Pulpo-Ozean, in dem das tentakuläre Denken von Donna Haraway aufschimmert und sich ins Planetarische weitet.
„Planetarische Routen gestalte ich aus!“
VI MAKRELENWISSEN
Im letzten Kapitel „Makrelenwissen” kippt der Aufbruch, die Revolte, wird einer Gegenprobe unterzogen. Tonfall und Bildsprache sind so massiv von Zweifeln durchtränkt, dass Utopisches der Rede kaum noch wert zu sein scheint. Stattdessen lesen wir von einer Übelkeit, die sich nicht beenden lässt, Orientierungslosigkeit zwischen Gedanke und Aufbruch, „Ödnisphobie”, Kadavergestank und Trost, der unnahbar ist. Selbst die Quäler seufzen nur noch untätig bei Regen. In Anlehnung an Nietzsche heißt es resignativ: „Wir sind die Vorletzten.”
Ein fast schon defätistisches „Makrelenwissen”, das sich nicht schert um pelagische Schleppnetze, ob es bereits am Haken hängt und in welcher Tafelrunde es demnächst serviert wird.
Am Ende heißt es: „Das Makrelenwissen und das Menschenwissen. Wann schnappen sie zu? Wann nehmen die Wellen sie mit”?
Ein Happy End klingt anders, es ist nicht mal ein offenes Ende, es ist pure sich fortschreibende Ambivalenz, bis man wie in einem Reel wieder an den Anfang gelangt und alles von vorne beginnt.
VII MUSH MUSH MUSH
So bebe ich, keschre im Wind …
Mush ist zweifelsohne einer der beeindruckendsten deutschsprachigen Lyrikbände der letzten zehn Jahre. Ein Band, der zum Reflektieren anstiftet, das Wesen der Metamorphose im Blick, fortlaufend Standpunkte und Perspektiven wechselt, Schicht auf Schicht legt in ein Auskundschaften, das „aus Rastern schweift” und paradoxerweise immer stringent bleibt, ein Band, der anarchischer Experimentierfreude genauso frönt wie dem Soziologischen und der Revolte. Mush schwingt sowohl auf der Metaebene als auch auf Alltagspraxen, changiert zwischen Nahaufnahme und Distanz („Distanz, ins Endlose gestuft”), nimmt das Patriarchale, Sozialkonstruktivistische, Unterdrückerische und vor allem Widerständiges in all seinen Widersprüchlichkeiten lustvoll in Augenschein.
Mal kühl oder dramatisch, mal grob klecksend oder filigran federstrichig, mal erzählerisch oder hochpoetisch, mal einen Plot auf fünf Zeilen verdichtend oder fragmentiert in abgeschnittene Verse sieht sich vom Brocke hybrider Schreibweisen verpflichtet, um den Preis eines Verzichts auf Offensichtliches, Naheliegendes. Die Texte wirken streckenweise wie Decollagen, wie Fetzen nebeneinanderklebender Erzählstränge, die Leerflächen wie von unsichtbaren Absperrbändern gesicherte Tatorte der Metamorphosen. Ein Body Counting makro- und mikrokosmischer Ränkespiele.
„Fast verloren” feiert vom Brockes Lyrik eine „unwägbare Schönheit”, die ausholt zum Schlag in den Nacken, im Rampenlicht metamorpher Horrorvisionen, den Morast als Nährboden sondierend, das wechselhafte sogenannte lyrische Ich als „bibberndes, transparentes Wesen, als fauchende Paladinin” zwischen Selbstzweifel und Empowerment outet.
So liegt in den Versen etwas paradox Leichtes und zugleich Umdüstertes. Vom Brocke nimmt die „sanften Dialoge” genauso in den Blick wie den „Aggressor Sonne”. Es ist dann eben keine sich im Finale herausschälende Utopia-Sichtung, sondern eine mal nüchtern-realistische, mal poetisch-durchgeknallte Draufschau, in der immer Spielerisch-Burleskes aufschimmert — die Conditio humana als commedia dell’arte.
Sonja vom Brocke: Mush. kookbooks, Berlin 2020. 80 S., 19,90 €