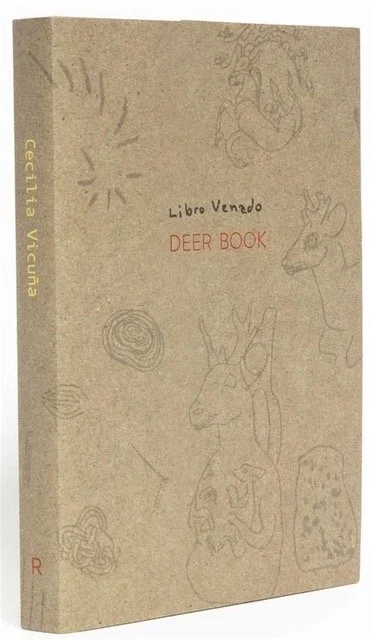Wahrnehmungsspiele auf der poetischen Guckkastenbühne.
Zu Farbleib von Saskia Warzecha
der Zögling streift durch den Garten
sucht Guckkasten
Mit diesen Versen lässt Saskia Warzecha direkt auf den ersten Seiten ihres zweiten Gedichtbandes Farbleib dessen zentrales Bild durchscheinen – den Guckkasten. Ihr Langgedicht schafft in sechs literarischen Streifzügen die Imagination eines Guckkastens im Sinne eines Blicks in eine andere Welt mit eigenen Regeln und Gesetzen. Warzecha knüpft hiermit an ihr Lyrikdebüt Approximanten (2020) an, das um die Frage nach Wegen und Schemata unserer Wahrnehmung kreist. Der Schauplatz, den Farbleib inszeniert, ist ein Haus mit Garten, und dort versucht sich der Zögling an einer Vermessung der Außenwelt – teilweise mit Hilfe seines Körpers:
Zögling übt Tiefe am Schacht
dann am Schächtelchen
fährt Auskleidungen ab
und übt dann am Finger verstehen
Er erhofft sich davon eine „Spukrast“ von seiner ihm gespenstisch und eigensinnig erscheinenden Umwelt, deren Eigenheiten Warzechas Sprache auch den Leser*innen vor Augen führt: So werden etwa Dachschrägen typographisch in Schrägstriche übersetzt, die zugleich (Zeilen)Brüche darstellen, und die Mehrdimensionalität des Wahrgenommenen wird durch Figuren der Wiederholung reflektiert:
so / hat Zögling sich / schließlich die Schrägen
geschmückt // am Fenster die Streben jetzt still
// glänzt innen’s Geländer // mehr als Skelett
in vier Dimensionen // Haus Haus Haus Haus
Doch der Zögling muss feststellen, dass sich seine Welt jeder Protokollierung und (sprachlichen) Fixierung entzieht. So wird etwa die Opposition von Statik und Dynamik aufgeweicht: Das Licht verursacht „Falten im Haus“, und der Zögling „knotet […] sich eine Leiter vors Fenster“. Feststehendes und Abgeschlossenes ist dem Gedichtband fremd – vielmehr erhebt er „ja – die Offenheit“ zu seinem Leitprinzip. Dementsprechend wird auch das Haus als „rückseitenlos“ (oder als „Netzhaus“ imaginiert. Durch diese Abwesenheit von Statik wird aus dem vermeintlich fest in der Erde verankerten Grabmal „– ein fortwährend auf den Boden fallender Stein“. Auch Bilder können keine Fixierung des Abgebildeten erwirken – sie beinhalten immer „eine Art Entfernung“. Auf Dauer nimmt nichts klare Umrisse an; Elemente und räumliche Dimensionen werden im Modus der Télescopage ineinandergeschoben und zusammengestaucht: Das Haus ist zugleich „Fisch-“ und „Vogelpalast“, schließt also Unter- und Überirdisches ein und verwischt sogar dessen Grenzen, denn in ihm „verwandelt ein Fisch sich in einen Vogel“. Der Wandel geschieht ständig und unaufhaltsam, „die Sonne scheint da / ihr keine Wahl bleibt auf nichts Treues“ – dem Zögling bleibt seine Umwelt somit immer fremd und unheimlich.
Eine neue Phänomenologie der Gegenwart
Aus der Fluidität der Gegenstände ergibt sich die Notwendigkeit, neue Formen der Wahrnehmung zu erproben. Wessen Perspektive könnte hierfür geeigneter sein als die eines am Anfang seiner Entwicklung stehenden und somit formbaren Zöglings, wie wir ihn etwa in Gestalt von Robert Musils Zögling Törleß oder Robert Walsers Jakob von Gunten aus der literarischen Moderne kennen? Warzecha versucht sich an einer Neukonstitution der Zeitlichkeit von Wahrnehmung. Sie erschafft gekonnt neologistische Komposita, indem sie den Substantiven adverbiale Bestimmungen der Zeit voranstellt, um den ständigen Wandel zu versprachlichen, dem die Gegenstände unterliegen:
und der Balken der eben noch
trug wird zum Eben-Balken der trägt
Eben- und Jetzt-Balken
tragen
So werden Tempuswechsel überflüssig, denn die Wahrnehmung wird als immer fortlaufender gegenwärtiger Akt imaginiert. In dieser neuen breiten Gegenwart fallen Vergangenheit und Zukunft zusammen. Es heißt also:
das Früher-Haus geht
das Später-Haus steht
statt
dies Haus ist gegangen
das Haus wird bestehen
Auf diese Weise wird der Lyrikband selbst zum Guckkasten, der seinen Leser*innen eine neue Wahrnehmung vor Augen führt und diese performativ sprachlich ausgestaltet.
Farbleib – zwischen Sinnleere und Bedeutungsschwere
Der Titel des Bandes – Farbleib – dient zugleich als Zwischenüberschrift für jeden einzelnen seiner sechs Teile. Im Inhaltsverzeichnis wird „Farbleib“ trotzdem nicht sechsmal ausgeschrieben, sondern seine Wiederholung wird durch Unterführungszeichen ausgedrückt. Schon bevor der Gedichtband richtig losgeht, konfrontiert er seine Leser*innen so mit einer reduzierten Sprache, die sich als zentrales Merkmal seines Duktus‘ erweisen wird: So zeigt Warzecha etwa, wie sich durch Homonyme verschiedene Bedeutungen in einem Ausdruck verdichten können oder wie minimale Abweichungen zwischen Wörtern — von „verneint“ und „verneigt“ oder „Verweisen“ und „Verwesen“ — eine maximale Bedeutungsverschiebung erwirken können. Doch wer oder was ist dieser Farbleib, der inhaltlich wie formal eine so zentrale Stellung in Warzechas Lyrik einnimmt? Auf diese Frage scheint es keine klare Antwort zu geben – der rätselhafte Begriff wird abwechselnd mit Bedeutung aufgeladen und als sinnleer entlarvt: Zumindest stellenweise präsentiert der Text „Farbleib“ als einen bedeutungslosen Ausdruck:
und Farbleib klammert nicht
und nicht ein und nicht aus
und kein Verweisen ist im Farbleib
Diese vermeintliche Abwesenheit eines Signifikats erinnert an Samuel Becketts Godot, auf den so lange vergeblich gewartet wird, bis bezweifelt werden muss, ob sein Name überhaupt auf etwas verweist. Auch Warzechas Farbleib ist eng mit dem Warten verknüpft, allerdings wartet niemand auf ihn, sondern er selbst „wartet im Haus“ (S. 9). Genau diese Verdrehung verleitet dazu, FarBLEIB als sprechenden Namen zu lesen, der auf dessen abwartende Haltung hindeutet. Dann wäre sehr wohl ein „Verweisen […] im Farbleib“ (S. 13). Und auch das Einklammern taucht nur wenige Verse nach dessen vorgeblicher Negierung zumindest auf typographischer Ebene auf. Ganz eindeutig steht es um die Bedeutung(slosigkeit) des Farbleibs also nicht. Ebenso verhält es sich mit seiner Funktion als Zwischentitel: Diese scheinen nicht primär der Gliederung zu dienen, denn mit ihnen gehen keine inhaltlichen Zäsuren oder Richtungswechsel einher. Vielmehr spielen sie den Farbleib in seiner selbstgenügsamen Warteposition immer wieder in den Fluss der Verse ein und stellen ihn damit dem umherziehenden ZÖGling gegenüber. Erst im letzten Abschnitt nimmt Warzechas raffiniertes Bedeutungsspiel mit dem Farbleib eine letzte Wendung, die selbst dessen vermeintliche Unerschütterlichkeit als Täuschung entlarvt:
und Farbleib tut
als ob er Farbleib bleibt
farbig
Leib
und bleibend
aber Farbleib lügt
Farbleib bleibt nicht
Also ist Farbleib doch kein sprechender Name? Und somit vielleicht doch bedeutungslos? Der Text lässt offen, ob der Guckkasten Farbleib leer ist, und wenn nicht, welche (Bedeutungs)Welten er enthält. Wenn der Zögling versuchte, sich seiner Umwelt mit althergebrachten Methoden zu nähern und ihr Gesetzmäßigkeiten überzustülpen, hat er sich
leicht […]
in eine Fastregel verdacht
einen Pfand
filigranen Ballast
Der Zögling „wird […] zum Scharniertier“ und gibt sich selbst neue Wege der Wahrnehmung frei. Warzechas Lyrik öffnet mit ihrer bewusstseinserweiternden Sprache einen Imaginationsraum, in dem alle Zeitebenen in einer weit gefassten Gegenwart aufgehoben werden. Als Guckkasten hält uns der Band eine Welt vor Augen, die nur aus immer sich wandelnden „temporären / -palästen“ besteht (der Verbindungsstrich lädt ein, an Gestern-Paläste, Jetzt-Paläste, Übermorgen-Paläste und jeden anderen denkbaren Palast zu denken), in denen jede vermeintlich allgemeingültige und überzeitliche Erkenntnis, jeder „Lichtfang entgleitet“. Also brauchen wir es damit gar nicht erst zu versuchen – aber wir dürfen es in den poetischen Wahrnehmungsspielen dieser Guckkastenpoesie.